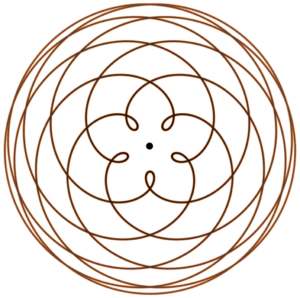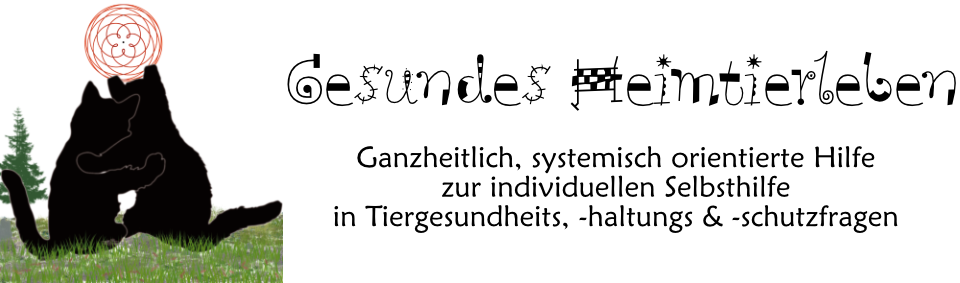Es war einmal…. Eine längere Geschichte vom „Spiel des Lebens“
Teil I. Wie die Spielregeln entstanden
Niemand weiß, wer sie hatte oder woher die Idee kam (aber wer weiß schon, woher Ideen kommen?) – eines Tages war sie vielleicht aus Langeweile, vielleicht aus einem kreativen Impuls heraus geschaffen: Die Idee zum Spiel des Lebens.
Es sollte ein ewiges Spiel sein, es sollte dabei immer spannend, „lebendig“, bleiben und sich ewig weiter entwickeln; alle Mitspieler sollten selbst die Spielfiguren sein und das Spiel aktiv mitgestalten können, sie sollten bestimmte Voraussetzungen und Fähigkeiten haben, aber auch lernfähig und kreativ sein, um sich neue Kenntnisse aneignen und persönlich weiter entwickeln oder diese auch an andere weitergeben und sich sogar selbst fortpflanzen zu können; alles Spielmaterial, das zur Verfügung stand, musste zu jeder Zeit (sinnvoll) benutzt werden und es würde niemals zusätzliches geben.
Es hatte lange gedauert – Milliarden Jahre, aber was ist das schon im Vergleich zur Ewigkeit – bis ein geeignetes Spielfeld feststand, also geschaffen worden war. Aber wer selbst kreativ tätig ist, weiß vermutlich, wie lange manche Projekte dauern können, und kann nachvollziehen, dass sich Fortschritte manchmal sehr langsam entwickeln, bis sie sich wenigstens zufriedenstellend anfühlen; dass immer wieder Veränderungen, Anpassungen, Ergänzungen notwendig werden können, bis das Ergebnis „gut“, „richtig“, „vollständig“ oder „fertig“ scheint – auch wenn es natürlich immer noch weiter verändert werden könnte.
Jedenfalls wurden für das Spielfeld unendlich viele Möglichkeiten auf ihre Tauglichkeit als Lebensraum parallel getestet. Sie hatten alle eine Kugelform gemeinsam, weil auch das Spielfeld endlos sein sollte. Damit diese Kugeln zusammen- und sowohl ihren Platz im Raum als auch ihre Balance behielten, so dass keine Spielfigur zukünftig herunterpurzeln würde, ergaben sie dadurch für das Spiel die ersten, unabänderlichen (physikalischen) Gesetze bzw. Kräfte wie Magnetismus und Schwerkraft, die überall gültig waren bzw. wirkten, auch wenn unter den unterschiedlichsten (Umgebungs-)Bedingungen die Auswirkungen natürlich stark unterschiedlich aussahen.
Manche Entwürfe waren glühende Feuerbälle, leuchtende Gasriesen oder Eiskugeln –, aber da sie Spielern keine vielfältigen (Über-)Lebensmöglichkeiten bieten und dadurch auch wenig Spannung liefern würden, fielen die zwar beeindruckendsten, aber damit zu „extremen“ Kandidaten für Lebewesen schnell aus der Auswahl. Sie blieben aber Teil der Umgebung, weil ja die Prämisse für das Spiel gewesen war, alles verfügbare Material zu nutzen und sinnvoll einzusetzen – vielleicht würden sie irgendwann im Laufe der Spielentwicklung doch noch gebraucht werden.
Ein ziemlich kleiner Planet namens Erde bot dann irgendwann die perfekten, vielfältigen, aber in ausbalancierten Verhältnissen stehenden (Lebens-)Bedingungen, um ein Spiel einfach zu beginnen: es gab von Anfang an etwas zu entdecken, selbst wenn man sich nicht von der Stelle bewegte: es wurde hell und dunkel, wärmer und kälter, so dass es Anreize gab, den eigenen Standort zu verlassen; und wenn man den Ort verließ, an dem man war, veränderte sich die Umgebung. Es gab Flüssigkeiten und Gase, durch die man sich tragen lassen oder aktiv durchschwimmen oder -fliegen konnte, aber auch festen, massiven Untergrund, für dessen Überquerung man sich eine Fortbewegungsweise einfallen lassen musste.
Die ersten einfachen Wesen, die sich aufgrund der Anziehungs- und Abstoßungsgesetze aus verschiedenen Bausteinen, Atomen, erst zu einfachen Molekülen und dann zu übergeordneten festen und/oder flüssigen Strukturen zusammengesetzt und gegen ihre Außenwelt mit einer Hülle abgegrenzt hatten, wiesen noch keine Anzeichen von eigenständigem Leben auf wie spontane, selbstgesteuerte Bewegungen und Reaktionen auf äußere Reize (z.B. das Meiden von Gefahren, aber auch das neugierige Auskundschaften neuer Umgebungen, von Ob- oder Subjekten). Erst als zwei verschiedene dieser Strukturen – die einen eine „tote“ Zellen, die anderen „totes“ Genmaterial – aufeinandertrafen und verschmolzen, fingen diese erste Organismen, diese ersten Lebewesen an, sich verändern zu wollen: sie lernten zu wachsen, entweder, indem sie erneut mit anderem Spielmaterial, Bausteinen, oder schon fertigen anderen Zellen verschmolzen, sie dabei sozusagen auffraßen oder sich von ihnen auffressen ließen. Und sie lernten, sich wieder zu teilen. Es war erstaunlich, welche Formen sie sich alle einfallen ließen, zu welchen neuen Organismen sie sich zusammentaten, um sich die Zeit zu vertreiben, die ja ewig war.
Schnell stand aber fest, weil Lebewesen eben so ihre Eigenheiten entwickeln und nicht alle gleich schnell größer wurden, während sie sich weiterentwickelten, dass es – zusätzlich zu den festen Gesetzen, die schon verhinderten, dass immer alles möglich war – weitere Grenzen für die Spieler gesetzt werden mussten: es wurden „die Spielregeln des Lebens“ aufgestellt, damit es z.B. für langsamere bzw. kleinere Mitspieler immer wieder neue Chancen geben würde aufzuholen oder Lebensräume zu besiedeln, die vorher Andere – Größere, Stärkere, kreativ-Schlauere, „Höherentwickelte“ – besetzt hatten.
Wer sich nicht an die hielt, flog ‘raus.
Und die erste lautete: Wer im Vergleich zu allen anderen zu stark oder zu schnell wächst, so dass das Gleichgewicht des gesamten Spiels zu sehr gestört wird, wird damit nicht lange überleben.
__________________________________________________
Dank für das Foto gebührt Mathias Csader: http://natur-highlights.de