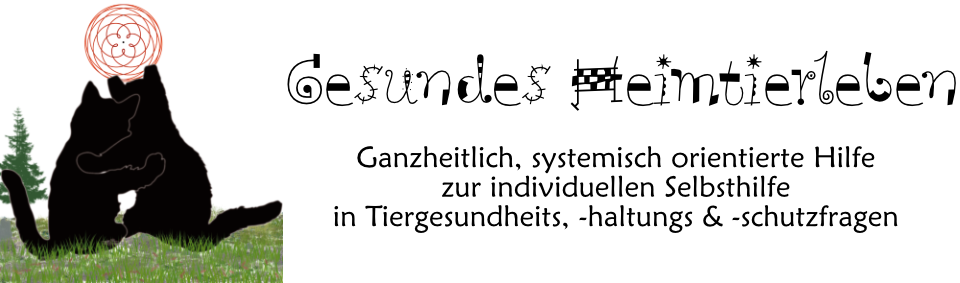Weil Tiergesundheit ein biologisches Thema ist…
… erhält dieser Blog Einzug in BiologieErfahren. Relvante Artikel sind unter Suchworten wie TIERGESUNDHEIT, ZEIT MIT DEM TIER oder HAUSTIERHALTUNG zu finden.
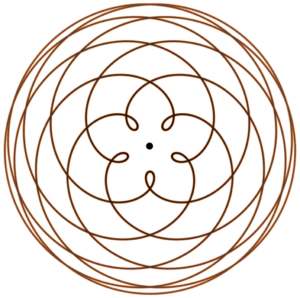
… erhält dieser Blog Einzug in BiologieErfahren. Relvante Artikel sind unter Suchworten wie TIERGESUNDHEIT, ZEIT MIT DEM TIER oder HAUSTIERHALTUNG zu finden.
Unsere Terrier-Hündin Peppie sucht in meinen Augen zwar insgesamt viel Blick-Nähe zu uns Menschen, ihren Rudelmitgliedern, aber eher selten längeren, direkten Körperkontakt. Ich habe keinen Vergleich zu anderen Hunden, weil ich sonst nur mit Katzen zusammengelebt habe (die sich oft überall und stundenlang gerne dazu gequetscht haben!); aber ich vermute, dass es bei Peppie unter anderem mit traumatischen Erfahrungen im Welpenalter zu tun hat, die sie nicht so leicht Vertrauen zu Menschen fassen lässt, zumindest nicht so viel, dass sie sich auch für längere Zeit entspannt neben sie legen könnte.
Sie schläft nachts generell in ihrem „Hundebett“ in unserem Schlafzimmer, verlangt aber vor allem morgens doch meistens Einlass in unsere große Version (seitdem sie nicht mehr selbst hineinspringen kann, wie sie es vorher einfach getan hat). Sie begnügt sich auch im Wohnbereich oft mit ihren „Kuschelkörbchen“, und wenn sie z.B. doch hoch zu uns auf die Couch möchte (sie bettelt nicht sehr deutlich, sondern stellt sich einfach demonstrativ davor), bleibt sie selten lange direkt neben uns liegen, sondern begibt sich auf die Decke, die dort am anderen Ende der Couch für sie platziert ist.
Da sich Peppie schon fast ein Jahrzehnt länger an Mathias als festen Teil ihres Rudels gewöhnen konnte, ist auch er immer noch die erste Wahl, wenn sie einmal einen Schlafplatz mit direktem Körperkontakt sucht; und da sie das sehr selten macht, vermuten wir, dass es ihr in diesen Momenten nicht besonders gut geht und sie jemanden zum Anlehnen braucht (vor allem, wenn ein schlechter Blutzuckerwert uns einen zusätzlichen Hinweis darauf liefert).
Von sexuellen Handlungen abgesehen, suchen die meisten Tiere direkten Körperkontakt zu anderen eher selten. Da sie zum Überleben auf ihre körperliche Unversehrtheit angewiesen sind, nähern sie sich möglichen Gefahrenquellen – auch in Form von Artgenossen – selbst oder besonders zur Paarungszeit eher vorsichtig, respektvoll, und lassen direkte Nähe vermutlich zu, wenn sie sich alleine bzw. schwach fühlen, wenn sie Halt oder Hilfe suchen, also beschützt werden wollen. Als „sozial“ bezeichnete Tierarten, zu denen auch wir Menschen gehören, Tiere also, die mehr oder weniger auf ein Leben in einer Gruppe, auf sozialen Halt, angewiesen sind, um in der Natur überleben zu können, scheinen liebevolle Berührungen sogar für ihr Überleben in der Kindheit zu brauchen: auch wenn z.B. die Waisenkinderversuche Friedrich II im Mittelalter nicht gesichert belegt sind, haben vor nicht allzu langer Zeit sowohl das Ärzteblatt als auch der Deutschlandfunk und GEO vermutlich nicht zum 1. Mal darüber berichtet. Dass auch erwachsene Menschen nicht nur für ihr seelisches Glück, sondern auch für ihre körperliche Gesundheit darauf angewiesen sind, daran besteht nicht nur für mich, sondern auch für Quarks im Westdeutschen Rundfunk kein Zweifel.
Als Gegenpart zur Suche nach Schutz nehmen Tiere, die eine Eltern-, Helferrolle oder Führungsposition übernommen haben, ihre „Schutzbefohlenen“ gerne in Schutz, nehmen sie „an die Hand“, um ihnen alles Überlebenswichtige beizubringen, gehen ihnen „zur Hand“, helfen also, wo sie noch Hilfe benötigen, oder nutzen bei Gefahr sogar ihren eigenen Körper als Schutzschild, um das Leben von Hilfsbedürftigen zu schützen.
In der Natur gilt es immer abzuwägen: Nehme ich die Gefahr des direkten Körperkontaktes zu anderen in Kauf, nehme ich in Kauf, dass sie mich leicht angreifen und verletzen können; möchte ich mich direkt ihren Bakterien und Viren aussetzen, die mich krank machen könnten, weil sie neu für mich sind?
Oder wiegen für mich die Vorteile des engen körperlichen Zusammenseins und -haltes mehr, z.B. gegen Kälte, gegen Angriffe anderer Gruppen von außen oder um mit gemeinsamen Körperkräften oder anderen -fähigkeiten etwas Größeres zu schaffen, als es mir alleine möglich wäre.
Einen gewissen, respektvollen Abstand zu anderen einzuhalten kann sicherer sein – direkter Körperkontakt war, ist und bleibt in der Natur und in unserer Zivilisation immer mit Risiken verbunden; aber viele Erfahrungen und Möglichkeiten können alleine nicht gemacht bzw. umgesetzt werden. Deshalb wählen z.B. wir Menschen sorgfältig aus, wem wir genug Vertrauen entgegen bringen, um uns ihm/ihr vielleicht schutzlos auszuliefern, und setzen – beruhend auf unseren Erfahrungen oder auch unserem Bauchgefühl – Grenzen, deren Überschreitung wir – genau wie jedes Tier – als persönlichen Angriff auffassen. Leider sind diese Grenzen unsichtbar, und ich bin heute sicher, dass ich in meinem bisherigen Leben schon mehr als eine überschritten habe, wenn ich fremde Menschen zur Begrüßung einfach umarmt habe. Für mich blieb das bisher ohne schlimme Folgen; vermutlich weil ich zu klein bin, um bedrohlich zu wirken, und weil bei Umarmungen normalerweise Glückshormone wie Oxytocin ausgeschüttet werden, die selbst negative Erfahrungen löschen (https://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article130360396/Die-dunklen-Seiten-des-Kuschelhormons-Oxytocin.html), also vielleicht auch die Wirkung ausgeschütteter Stress-, also u.a. Angriffshormone neutralisieren können. Aber woher weiß ich, dass ich in meinem bisherigen Leben noch nie jemanden mit meinen körpereigenen Bakterien und Viren gefährdet habe – vielleicht auch weil er/sie selbst nicht einmal wusste, dass er/sie zu einer Risikogruppe gehört, und mich hätte vorwarnen können? Hat sich darüber bisher irgend jemand Gedanken gemacht? Sollen wir das aber ab von jetzt an bis in alle Zukunft immer tun? Oder dürfen wir endlich wieder selbstverantwortlich entscheiden, wem wir uns nähern möchten, wem wir erlauben möchten, uns zu berühren – weil wir bereit sind, die möglichen Konsequenzen zu tragen – und wem nicht?
Verantwortungsvolle Eltern oder – tierische wie menschliche – „Führungspersönlichkeiten“, bringen ihren Schutzbefohlenen in meinen Augen Eigenverantwortung bei; bringen ihnen bei, zu kommunizieren, zu sagen, was sie (erlauben) möchten und was nicht.
Die anderen, die ihren Schutzbefohlenen nicht vertrauen, ihnen keine Eigenverantwortung zutrauen, greifen auf feste Regeln und Verbote zurück, die unter Strafandrohung durchgesetzt werden…
Ich wünschte mal wieder, ich dürfte mich einfach so verhalten, wie es mir die Natur vormacht, wie es im Tierreich gang und gäbe ist; denn da begegnet mir täglich mehr Vertrauen und Verantwortung, von der nicht nur gesprochen, sondern die tatsächlich getragen wird, als unter Menschen…
_______________________________________________
Dank für das Foto gebührt Mathias Csader, natur-highlights.de
Da unsere lebenswichtigen Körperfunktionen ja automatisch ablaufen (können), müssen wir Menschen im Leben in erster Linie eines: die Konsequenzen dafür tragen, wofür oder wogegen wir uns entscheiden. Wenn mir also jemand erzählt, er/sie „müsste“ etwas tun, sagt mir das also vor allem, dass er/sie nicht die Konsequenzen davon tragen möchte, sich dem zu verweigern. Da ich kürzlich den Satz gehört habe „Irgendein Haustier muss ich den Kindern ja erlauben“, habe ich mich gefragt, wie jemand zu dieser Entscheidung bzw. zuerst einmal auf diese Idee kommt…
Gibt es ungeschriebene Gesetze (von denen ich als Kinderlose nichts weiß), die Mama und Papa vorschreiben, dem Wunsch des Kindes nach einem Haustier nachzukommen? Gilt das einfach deshalb, weil „alle“ anderen auch eins kriegen und er/sie sonst ein schlechter Papa/eine schlechte Mama ist und nicht mehr geliebt wird? Weil er/sie sonst schon so viel verbietet? Weil er/sie denkt, es sei wichtig für die Entwicklung eines Kindes, mit „Hilfe“ eines Haustieres Verantwortungsbewusstsein zu lernen? Weil es den Bezug zur Natur fördert und Kinder dadurch lernen, dass nicht jede/r dieselben Bedürfnisse hat? Ich wünschte, meine Erfahrungen würden mich überzeugen, dass Letzteres der Grundgedanke dahinter wäre – dann wäre wenigstens der ein sinnvoller…
Ich bin nicht generell gegen die Haltung der meisten Haus- und/oder Heimtiere; aber meine Liebe zu Tieren und zu Freiheit bzw. Freiwilligkeit lässt sich einfach nicht gut mit der Haltung in Käfigen oder innerhalb von Wänden vereinbaren. Da wir Menschen uns einen sehr unnatürlichen Lebensstil, sehr entfernt von der Natur, angewöhnt haben, sehe ich immer mehr Schwierigkeiten darin, Tieren eine möglichst artgerechte Umgebung bieten zu können, in der Tiere die Möglichkeit haben, ihre natürlichen Bedürfnisse ausleben, die für ein gesundes Leben essenziell sind. Ich würde heute also sagen: Ich bin aus Tierschutzgründen prinzipiell dagegen; ABER…
Ich sehe immer wieder Menschen und Tiere zusammen, die auf mich den Eindruck machen, als wären sie ein unschlagbares Team, Zwei (oder Mehrere), die zusammen gehören, die beide (alle) vom Zusammenleben in dieser „Beziehung“ mehr profitieren als einseitig Zugeständnisse machen zu müssen und eventuell darunter zu leiden. Ich würde mir nicht anmaßen wollen, diese nur aus Prinzipientreue zu verurteilen oder sogar verbieten zu wollen. Ob Kinder zu solch einer Beziehung fähig sind, lässt sich leider nur dadurch herausfinden, dass man es sie ausprobieren lässt… zum Leidwesen vieler Tiere, die trotz viel Aufklärungsarbeit und Vorüberlegungen immer noch in Müllkontainern entsorgt werden, im Tierheim landen, ausgesetzt oder zwar weiterhin versorgt werden, aber irgendwann vielleicht einsam und in ihren eigenen Fäkalien vor sich hinvegetieren. Wünschen würde ich mir zwar, dass man diese sich in regelmäßigen Abständen wiederholenden Dramen endgültig aus der Welt schaffen könnte; aber ich bin gegen Gesetze, die natürliche Bedürfnisse der Menschen zu verbieten versuchen: und vermutlich hat so gut wie jedes Kind dieses Bedürfnis nach einem oder mehreren tierischen Begleitern oder nach einem lebendigen Wesen, um das es sich kümmern kann. Spannend finde ich persönlich, dass nur wenige Kinder dieselbe Erfüllung durch andere, kleinere Kinder finden – aber darum soll es hier nicht gehen.
Im Sinne der gesunden Entwicklung von Kindern sollte das Sicherheits-Bedürfnis (nach einem treuen Freund) oder das „Helfersyndrom“, also das soziale Bedürfnis, sich um andere zu kümmern, von Kindern auf keinen Fall mit Gewalt oder Verboten unterdrückt werden. Der Fokus auf ein bestimmtes Haustier könnte allerdings umgelenkt werden – es müssten also für die „Bedürfnisbefriedigung“ von Kindern nicht unbedingt Tiere herhalten, die heute meistens in Käfigen gehalten werden („müssen“).
Trotzdem scheinen vielleicht einige, vielleicht mehrere, vielleicht die meisten Kinder ihre Eltern immer noch früher oder später von der „Alternativlosigkeit“ eines eigenen Haustieres überzeugen zu können – wie ich selbst es vor vielen Jahren einmal bei meinen Eltern geschafft habe. Heute zeugt es in meinen Augen von sehr wenig Verantwortungsbewusstsein (nicht nur gegenüber Tieren), wenn Eltern ihren Kindern die vielleicht erste Verantwortung im Leben relativ oder komplett alleine überlassen: Ich z.B. musste nur versprechen, mich um alles, was mein Kaninchen betraf, zu kümmern – was ich mir mit meinen 9 Jahren natürlich voll zutraute. So wie vermutlich alle Kinder, die sich ein Haustier wünschen. Ich erkläre mir das blauäugige Verhalten meiner Eltern heute lieber damit, dass ich ihr erstes Kind war und sie auch erst lernen „mussten“, wie viel Verantwortungsbewusstsein sie ihrem Kinde zutrauen können, als damit, dass sie überhaupt nicht über das Wohl von Tieren nachgedacht haben. – Vielleicht frage ich sie irgendwann einmal danach…?
Im Nachhinein würde ich sagen, dass „Stupsi“ einige schöne, ereignisreiche Jahre bei mir hatte – sie war ein Stallkaninchen von einem Bauernhof, allerdings kein großer „Stallhase“, sondern ein Zwergkaninchen; sie lebte anfangs mit ihrem, fälschlicherweise als Schwester abgegebenen, Bruder (der ein Aggressionsproblem hatte und meinen Bruder so sehr attackierte, dass er ihn schweren Herzens zum Bauernhof zurückbrachte); danach wechselten Zeiten alleine mit WG-Zeiten ab: einer längere (bis zu dessen Tod) mit einem älteren Kumpel, der seinen vorigen verloren hatte und keinen neuen bekommen sollte, außerdem kurzzeitig eine mit einem gefundenen Feldkaninchenbaby, und ihre letzten 2 bis 3 Jahre wieder alleine in einem selbstgebauten Stall im Garten. Sie hatte viel Freilauf, weil sie den Garten nie verlassen, sondern sich bei Gefahr (z.B. in Form von Nachbarkatzen) höchstens zurück in ihren Käfig geflüchtet hat; ich habe mit ihr Ausflüge in den Wald gemacht und oft auf die Nachbarwiese, von der sie mir – auch über die kaum befahrene Straße – immer zurück nach Hause gefolgt ist, wenn ich genug Löwenzahn- und Klee für sie gepflückt hatte. Sie durfte in der kalten Jahreszeit oft in die Wohnung (und Telefonkabel anknabbern) – obwohl ich damals noch nicht davon gehört hatte, dass Kaninchen auch lernen können, ein Katzenklo zu benutzten, sondern in Kauf nahm, hinterher Urinecken sauber zu schrubben und ihre „Hasenknödel“ einzusammeln. Aber sie lebte eben, bis ich 15 war – und ab 13 hatte ich als Teenager einfach ziemlich viele andere, neue Interessen…
Die Lebenserwartung eines Tieres ist also ein Faktor, der in jedem Fall immer mit berücksichtigt werden sollte, wenn jemand aus Tierliebe ein Tier bei sich einziehen lassen und ihm/ihr ein möglichst artgerechtes Zuhause einrichten möchte. In die Zukunft schauen lässt sich immer schwer, vor allem, wenn es sich um viele Jahre oder sogar Jahrzehnte (wie bei vielen Vögeln oder Reptilien) handeln kann – und vermutlich können bzw. wollen die wenigstens Menschen, die ehrlich zu sich selbst sind, gar nicht so lange in die Zukunft mit einem Tier planen. Relativ kurzlebige Haustiere wie Hamster oder andere nachtaktive Lauftiere können eigentlich gar nicht artgerecht gehalten werden – sie sind zwar Einzelgänger, also außer zur Fortpflanzung nicht unbedingt auf Sozialkontakte angewiesen, beschäftigen sich dafür aber vermutlich in ihrer natürlichen Umgebung – während sie große Strecken zurücklegen – mit vielerlei, abwechslungsreichen Dingen, die wir ihnen in einem Zimmer nie bieten könnten; Mäuse und Ratten, die auch keine sehr lange Lebenserwartung haben und vermutlich mehr Spaß an Sozialkontakten mit Kindern und Beschäftigung während des Tages hätten, stinken vielen schnell zu stark, und sie sind vermutlich auch nicht glücklich, wenn nicht mindestens noch ein paar Artgenossen in ihrer Nähe sind – ich muss sagen, die Auswahl an „geeigneten“ Haustieren für Kinder im Sinne von Tierliebe ist ziemlich mau.
Außerdem denken vermutlich die wenigsten Eltern und Kinder daran, wie viele Tiere heute unter elenden Zucht- und Transportbedingungen leiden müssen, wie viele, v.a. der Nachwuchs exotischer Tiere, zum Teil illegal in der freien Natur eingefangen werden, wie viele auf dem Weg zu einem „Züchter“, in eine Zoohandlung, oder dort vor Ort sterben, damit viele andere verkauft werden können. Solange es eine Nachfrage nach diesen Tieren gibt, solange Menschen diese Tiere auch immer wieder retten wollen, werden neue „nachproduziert“ werden und auf der Strecke bleiben, das sollte jedem Tierfreund bewusst sein. Auch Tierheime „profitieren“ paradoxerweise ja von Tierleid, weil es sie ohne hilfsbedürftige Tiere gar nicht gäbe – daher ist auch mein Verhältnis zu Tierheimen heute sehr zwiespältig. Ich habe aber beschlossen, mir kein abschließendes Urteil darüber zu bilden, wer warum welche Tiere halten möchte. Die Rettung eines Tieres birgt oder verursacht vielleicht sogar das Leid eines anderen – zumindest so lange irgendjemand Geld dafür bezahlt und jemand anderes daran verdienen kann. Jede/r kann daher nur für sich selbst entscheiden, was er/sie verantworten möchte, wem er/sie helfen möchte, ob ein eigenes Haustier für das Kind sinnvoll ist. Aber dazu braucht es Informationen und Vorüberlegungen, also ein bisschen Zeit…
Ich selbst bin übrigens seit mehr als 20 Jahren nicht mehr von alleine auf die Idee gekommen, ein Haustier halten zu wollen… Aber … 2007 hatte die damalige Nachbarkatze kurz vor ihrer Kastration einen „Ausreißer-Unfall“ mit ungeplantem Nachwuchs, so dass meinen Ex-Freund heute noch „unsere“ 2 Katzen begleiten. Und vor 2 Jahren habe beim Einzug in mein jetziges Zuhause die Hündin meines Freundes sozusagen mit-adoptiert – nach gemeinsamer Absprache haben wir sie, weil sie mit ihren epileptischen Anfällen und Diabetes vielleicht keinen Umzugsstress in ein komplett fremdes, neues Zuhause überlebt hätte, von einer Freundin übernommen, die sie schweren Herzens abgeben musste. Ich bestreite nicht, dass ich damit ein Helfersyndrom auslebe (für das ich immer wieder ziemlich viele Kompromisse eingehen muss, die ich freiwillig, ohne meine Verantwortung für ein Tier zu berücksichtigen, nicht eingehen würde…). Viel lieber würde ich mich oft aus der Verantwortung stehlen und meine Tierliebe einfach in stiller Bewunderung der Natur, in meiner Faszination für Tiere und für ihre unterschiedlichen Überlebensstrategien ausleben! Blöderweise haben Menschen mit ihrem Bedürfnis, Tiere zu domestizieren, es geschafft, dass heute nicht nur die Natur und Wildtiere viel Hilfe brauchen, sondern zusätzlich unsere sogenannten Haustiere, „Nutz“- und Heimtiere.
Zum Schluss also meine prinzipielle Meinung zur Haltung von Heimtieren (zu „Nutztieren“ fällt mir bestimmt ein anderes Mal etwas ein, und zu den vielen anderen Möglichkeiten, Tieren zu helfen, z.B. Wildtiere mit Futter, Wohnräumen und Brutplätzen zu versorgen oder ihre Lebensräume zu schützen, bestimmt auch):
Hund und Katze oder auch Ratten, Mäuse und andere Tiere, die in der Evolution freiwillig die Nähe des Menschen gesucht haben, fühlen sich vermutlich auch als Haustiere in Wohnräumen und auch als Begleiter von Kindern am wohlsten, können also relativ artgerecht gehalten werden, wenn ihre individuell unterschiedlichen Bedürfnisse nach geschützten Plätzchen, artgerechter Nahrung, Bewegungsraum und Beschäftigung sowie Sozialkontakten berücksichtigt werden. Kaninchen und Meerschweinchen und alle Tiere, die am liebsten in Gruppen mit Artgenossen leben, sind eher was für Kinder, die viel Platz für sie zur Verfügung haben, am besten mit Gartenanbindung, und die vor allem Spaß daran haben, Freigehege und Beschäftigungsmöglichkeiten für ihre Tiere zu basteln und die Tiere dann bei der Nutzung zu beobachten, statt sie herum zu tragen und mit ihnen spielen und kuscheln zu wollen.
Diverse Tierarten können also bestimmt auch in Obhut eines Menschen ein glückliches, gesundes Leben führen. Im Sinne des Tierwohls, aber auch, um ihre Kinder nicht irgendwann mit Schuldgefühlen zurück zu lassen, „müssten“ sich Eltern allerdings ehrlich damit auseinandersetzen, welches Tier zu den eigenen Kindern und zum eigenen Lebensstil passt. Viele Informationen dazu finden sich auf den Websites diverser Tierheime oder Tierschutzvereine, z.B. https://www.tierschutzbund.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Broschueren/Welches_Tier_passt_zu_mir.pdf. Wenn, auf welchen Wegen auch immer, doch einmal ein Tier ungeplant eingezogen ist, das einer Art angehört, von der man eigentlich noch gar nichts weiß oder mit deren Haltung man sich noch gar nicht auseinandergesetzt hat, liefern bestimmt nicht nur Biologen gerne Informationen, welche natürlichen Bedürfnisse erfüllt werden müssten, um die Voraussetzungen zu schaffen, dem Tier ein gesundes und vielleicht auch glückliches Leben zu ermöglichen.
Schon als Kind hatte ich nicht das Gefühl, einen „ständigen Begleiter“ wie den Hund zu brauchen, sondern habe immer eher den Kontakt zu Katzen gesucht und ihnen in frühen Jahren meine Gesellschaft und Nähe vermutlich öfters „aufgezwungen“, als ihnen eigentlich lieb war. – Zumindest wenn sie es, nachdem ich vielleicht einfach die Schnellere war, nachgiebig toleriert und mich nicht frühzeitig in meine bzw. ihre Grenzen gewiesen haben.
Heute nähere ich mich Katzen sehr viel respektvoller. Nicht nur, weil es mir von den Katzen persönlich beigebracht wurde, ich es aus also aus schmerzhafter Erfahrung gelernt habe, sondern weil mir heute bewusst ist, dass Tiere wie Menschen eine Persönlichkeit besitzen und ich ihnen daher auch Persönlichkeitsrechte einräume. Ich lasse mich auch nicht gerne ungefragt von Fremden anfassen lassen, nur weil die mich süß finden!
Weil es vielen
Tieren nicht ausreicht, mit ihren Augen zu beurteilen, ob sie
Körperkontakt zulassen möchten, und obwohl sie keinen
Begrüßungs-Handschlag kennen, habe ich mir angewöhnt, mich ihnen
möglichst langsam bis auf ein paar Schritte zu nähern, mich auf
ihre Augenhöhe zu begeben, d.h. in die Hocke zu gehen, und ihnen
erst einmal vorsichtig eine Hand, bzw. meinen HandRÜCKEN entgegen zu
halten. Das erscheint mir als freundlichste Variante, seitdem ich
einmal gelesen habe, dass die geöffnete Hand eines Menschen für
eine Katze, aber auch für viele andere Tiere, bedrohlich wirken
kann.
Viele Katzen, die mir in meinem Leben begegnet sind, sind ziemlich schnell auf dieses „Freundschaftsangebot“ eingegangen. Für die meisten, die schon länger mit Menschen zusammen leben und noch keine schlechten Erfahrungen mit Menschen gemacht haben, ist das vermutlich der „Startschuss“ zur Kraul- und Streichelmassage – sie leisten ihm oft schnurrend, unter Frontalannäherung, Folge!
Etwas unsicherere Vertreter der Art Felis silvestris catus wählen zur eigenen Absicherung statt des Schnurrens auch mal ein Fauchen während sie sich selbst – Flanke voran – nähern, so dass man als „Handanlegerin“ darauf aufmerksam gemacht wird, sorgsam auf den Moment zu achten, zu dem die Unsicherheit in Ablehnung umschlägt, die Katzen oft mit dem Einsatz ihrer Krallen betonen
.
Eigentlich sollte
man ja bei jedem Kennenlernen nichts überstürzen; aber bei Liebe
auf den ersten Blick oder einfach großer Begeisterung für das
Gegenüber fällt es vermutlich vielen Menschen schwer, sich selbst
im Zaum zu halten. Vielleicht hat uns unsere Kultur in dieser
Hinsicht etwas von unserer natürlichen Scheu vor Fremden genommen
und „unvorsichtiger“ gemacht?
Auf jeden Fall erinnern uns
viele Katzen „zum Glück“ auf ihre persönliche, leider für uns
oft schmerzhafte und blutige, aber dadurch sehr nachhaltige, Art und
Weise immer mal wieder daran. Wer weiß, wie oft ich – durch diese
Übung im Umgang mit Katzen – in anderen Situationen schon davor
bewahrt wurde, übereilt zu handeln? (Leider nicht oft genug; aber
das ist eine bzw. sind vermutlich viele andere Geschichten…) 😉
Es steht auf jeden
Fall fest, dass Katzen zumindest VERSUCHEN, mit uns zu kommunizieren,
bevor sie ihren „Worten Taten folgen lassen“, mal mehr mal
weniger geduldig; und mal mehr, mal weniger von Erfolg gekrönt.
Ich
empfinde es immer wieder als große Bereicherung in meinen
Beziehungen zu Katzen, wenn ich das Gefühl habe, es geschafft zu
habe, mich ihnen verständlich zu machen (mit Worten oder anderen
Tönen und Geräuschen, Mimik und Körperhaltung oder Gesten und
Verhaltensweisen), oder sie – anhand ihrer Mimik und Körpersprache,
ihrem Verhalten, ihren Lauten oder auch mal intuitiv – zu
verstehen!
Auch sie verstehen
unsere Sprache ja nicht intuitiv, instinktiv, scheinen sich aber sehr
viel Mühe dabei zu geben (immerhin geht es ja oft ums eigene
Überleben, also eine Futterquelle!), unsere Worte und unser
Verhalten im Gesamtzusammenhang von Situationen zu deuten.
Umgekehrt
können wir die Sprache(n) der Tiere genauso lernen – vor allem durch
genaue Beobachtung in den unterschiedlichsten Situationen. Und wenn
wir Menschen tatsächlich die intelligentere Spezies sind, bin ich
der Meinung, dass es vor allem unsere Aufgabe ist, entstandene und
immer wieder neu entstehende Missverständnisse auszuräumen!
Dass es davon viele zu geben scheint, davon „erzählen“ mir die vielen (zunehmenden?) Probleme im Zusammenleben mit Katzen, in erster Linie Verhaltensauffälligkeiten und chronische (Stress-)Erkrankungen.
Nicht nur die bieten mir ausreichend Material für noch viele neue Blogartikel – bis zum nächsten also! 🙂
Über Tiere „weiß“ man ja so einiges, das heißt, vieles gilt heute sogar als wissenschaftlich erwiesen: Über ihr Verhalten, ihre Kommunikationsformen, ihre artgerechte Haltung und Ernährung, die Ursachen und Behandlung ihrer Krankheiten und vieles mehr.
Ich persönlich habe mich lange Zeit gefragt, warum immer wieder mal etwas, das ich selbst in meinem langjährigen Zusammenleben und -arbeiten mit Tieren beobachtet oder auch über sie gehört und gelesen habe, nicht zu dem passt, was anscheinend viele andere Menschen „wissen“. Mittlerweile habe ich einige Erklärungen dafür, warum das so ist:
1) Jede wissenschaftliche Arbeit gründet auf einer Annahme, einer THESE oder THEORIE, für die unter reproduzierbaren, WISSENSCHAFTLICHEN (STANDARD-)BEDINGUNGEN Belege gesucht und gefunden werden müssen, damit sie als „bewiesen“ gilt. Eigentlich wird also nicht davon ausgegangen, dass die Ergebnisse auch unter anderen Bedingungen dieselben sind. Um z.B. etwas über das Verhalten von bestimmten Tierarten zu lernen, muss immer berücksichtigt werden, in welcher Situation genau das jeweilige Verhalten erforscht wurde.
2) Für die Beweiskraft einer wissenschaftlichen Studie genügt eine „statistische Wahrscheinlichkeit“, nicht etwa eine 100%ige Bestätigung der Annahmen. Ausnahmen, die leicht auf INDIVIDUELLE UNTERSCHIEDE zwischen den „Studienobjekten“ zurückzuführen sind, also hier Tieren, finden in Studien kaum Berücksichtigung.
Mir persönlich ist allerdings nicht wichtig, was NUR UNTER BESTIMMTEN BEDINGUNGEN, MEISTENS oder FÜR VIELE gilt – auch wenn Wissenschaftler/innen das herausgefunden haben – sondern was für ein Tier IM EINZELFALL wichtig und in seinem speziellen Leben praxistauglich ist!
Und das kann bei verschiedenen Individuen derselben Tierart sehr, sehr unterschiedlich sein; einfach dadurch, dass sie sich an unterschiedliche Lebensumstände angepasst haben und sehr unterschiedliche Erfahrungen in ihrem Leben machen!
3) Darüber hinaus beruht jede Theorie auf den Grundannahmen dessen, der/die sie aufstellt; das heißt dem, was der oder die betreffende Wissenschaftler/in VORHER z.B. schon gelesen, beobachtet und/oder im besten Fall selbst überprüft hat.
Deshalb unterscheiden sich vor allem die Grundannahmen unter Wissenschaftlern häufig enorm! Und ich habe immer wieder den Eindruck, dass viele nicht einmal bemerken, dass sie sich nicht über Forschungsergebnisse streiten, sondern „nur“ über die Erkenntnisse, die sie daraus ziehen, also ihre unterschiedliche Deutung (aufgrund ihrer Vorerfahrungen, ihres Vorwissens). Denn Daten oder sonstige Forschungsergebnisse sprechen nie für sich, sie müssen gedeutet werden, um daraus eine Erkenntnis zu gewinnen; und „blöderweise“ können unterschiedliche Grundannahmen einfach unterschiedliche Deutungen der Ergebnisse liefern.
Aber zurück zu den Tieren:
Entgegen der anscheinend weitverbreiteten Grundannahme, dass z.B. Hunde den Menschen „gefallen wollen“ (zumindest habe ich diese Formulierung schon sehr häufig gehört!), gehe ich persönlich davon aus, dass sie – wie vermutlich alle Lebewesen – möglichst wenig Stress mit uns Menschen oder anderen Tieren haben wollen, sich gut fühlen und Spaß haben möchten an dem, was sie tun.
Welche Grundannahme jetzt die „richtige“ ist oder ob sie beide ihre Berechtigung haben, darüber darf gerne gestritten werden – ich persönlich halte Zeit für zu wertvoll, um sie damit zu verschwenden. Ich orientiere mich lieber daran, ob mir etwas plausibel erscheint, und wenn nicht, ob und wie es überprüft und begründet wurde (Und wie bitte fragt man Hunde, ob sie etwas wirklich WOLLEN?).
Meine Grundannahmen beruhen auf biologischen Prinzipien; im Falle des Hundeverhaltens auf Ressourcenschonung, also möglichst wenig Energieverbrauch auf körperlicher und – in meinen Augen – auch psychischer Ebene.
Unser heutiges „Wissen“ ist nichts anderes als die Aneinanderreihung von (älteren) wissenschaftlichen Grundannahmen-Studien-Ergebnissen, neuen Grundannahmen-Studien-Ergebnissen usw.
Dadurch ist Wissensgewinn enorm anfällig für Missverständnisse, Auslassungen, einseitige Darstellungen u.ä. Und entweder bemerken das viele Wissenschaftler selbst nicht oder sie schaffen es, ihre Erklärungen für alle anderen Menschen absichtlich so unverständlich (aber plausibel klingend!) zu formulieren, dass die gar nicht auf die Idee kommen, diese zu hinterfragen.
Wenn zum Beispiel unsere Hündin Peppie nicht mit mir Gassi gehen mag, gebe ich mich nicht mit der nächstliegenden Begründung zufrieden „Sie hat halt keine Lust“, sondern ich frage weiter: „WARUM hat sie keine Lust?“ Ist es das Wetter (zu nass, zu kalt zu warm?), hat sie zu wenig Energie (schlechter Blutzuckerwert), hat sie Schmerzen (in ihren alten Knochen) oder hat sie vielleicht Angst (wenn direkt vor der Haustür schon „gefährliche“ Düfte anderer Hunde in der Luft liegen).
Denn dass ein Hund GENERELL nicht gerne ‘raus an die frische Luft gehen, erscheint MIR aus biologischer Sicht einfach nicht plausibel. Meine GRUNDANNAHME ist, dass er das gerne tut oder tun (würde), weil es ihm und seiner Gesundheit gut tut.
Peppie bestätigt diese, indem sie meistens doch noch Spaß an einer Schnüffelrunde draußen zu finden scheint – wenn ich vermutete Start-Hindernisse beseitige: sie massiere, ein Stückchen trage, mich bei der Begegnung mit anderen Hunden vor sie stelle (damit sie nicht in die Versuchung kommt, die Situation selbst regeln zu wollen/müssen), sie ermuntere (am besten funktioniert das bei ihr mit „Leckerlis“, wozu glücklicherweise auch Gemüsestückchen zählen!).
Für mich persönlich habe ich auch etwas gelernt: Ich möchte mich mit niemandem streiten, der/die meine Grundannahmen nicht teilen kann.
Als Wissenschaftlerin sehe ich es als meine Aufgabe, mir selbst und anderen immer wieder neu die Frage „Warum“ zu stellen, bis Fragen irgendwann zufriedenstellend beantwortet sind und sich Probleme damit lösen lassen.
Das führt mich immer wieder zu neuen Erkenntnissen über Tiere, die diesen hoffentlich irgendwie zu Gute kommen.
Dazu bald mehr!
Es gab Zeiten, da hatte ich sehr viel öfters das Gefühl, meiner gesamten Mitwelt unbedingt Dinge mitteilen zu wollen: Dinge, die mir wichtig, sinnvoll, gut, hilfreich, richtig… erscheinen. Und die ich früher ganz pauschal dann auch wichtig, sinnvoll, gut, hilfreich, richtig, … für alle anderen hielt.
Jaja, das Problem mit den Generalisierungen…
MIR ist durch viele Erfahrungen vor allem in den letzten 10 Jahren bewusst (gemacht) worden, dass FÜR ANDERE MENSCHEN oft ganz andere Dinge wichtig, sinnvoll, gut, hilfreich, richtig, … sind: An vielen Stellen komme ICH einfach nicht weiter, wenn ich, um meine Weisheiten in die Welt tragen und die Probleme ANDERER lösen zu wollen, in erster Linie von mir und dem, was ich so an Erfahrungen gesammelt und gelernt habe, ausgehe.
(Die groß geschriebenen Wörter sollen nur verdeutlichen, an welchen Stellen ich selbst immer noch in Versuchung gerate, mit „man“ zu generalisieren…)
Es wäre ja so schön und einfach, wenn es (Heil-)Mittel, Ernährungs-, Verhaltens-/Erziehungs- und sonstige -Tipps geben würde, die bei jedem Tier (derselben Tierart) gleich gut funktionieren.
Aber die Biologie hat mich gelehrt, dass das der Individualität von Lebewesen und der Variation zwischen ihnen ziemlich widerspricht: Jedes einzelne Lebewesen hat seine einzigartige genetische „Vorgeschichte“ (selbst eineiige Mehrlinge haben gewisse körperliche Unterschiede), jedes macht seine eigenen individuellen Erfahrungen im Leben, lernt, sich auf seine Weise zu bewegen, passt sich individuell an unterschiedliche Nahrung an und … und … und …
Deshalb ist es in meinen Augen für jede/n Tierhalter/in in erster Linie wichtig – wenn er/sie bestmöglich für DAS EIGENE TIER sorgen und ihm ein gesundes Leben ermöglichen möchte -, sein/ihr Tier zu kennen, d.h. möglichst genau beobachten und auch deuten zu können.
Zwar verbringen Tierhalter/innen ja mehr Zeit mit ihrem Liebling als jede/r andere und haben die meisten Möglichkeiten, ihn genauestens zu beobachten; aber nur, wer weiß, worauf er achten kann, kann auch hilfreiche Schlüsse daraus ziehen. Und es gibt so wahnsinnig viel zu beachten…
Nicht jeder der Tipps und Ratschläge, die heute irgendwie überall kursieren, passt zu jedem Tier und seiner Lebenssituation und kann Erfolg versprechen.
Der Satz „Ich hab‘ schon ALLES versucht“ überzeugt mich jedenfalls seit Langem nicht mehr. Es gibt einfach soooo Vieles, was funktionieren könnte. Und nur weil ich selbst irgendwann auf keine anderen Ideen mehr komme, heißt das noch nicht, dass nicht ein/e andere/r darauf käme. Für mich ist es keine Überraschung, dass ganz oft auf einmal etwas funktioniert oder hilft, was ein anderer nie vermutet hätte. Weil unterschiedliche Menschen andere Ideen und Sichtweisen haben und unterschiedliche Dinge ausprobieren.
Seitdem ich ganz bewusst versuche, möglichst viele andere Sichtweisen und Erfahrungsberichte in meine Überlegungen einzubeziehen, lerne ich viel mehr Neues dazu; brauche aber auch Zeit, das auch alles für mich einzuordnen.
Es ist wirklich zeitaufwendig, Augen und Ohren offen zu halten für möglichst alles, was mit Tiergesundheit zu tun hat… Von Tierphysiologie über Verhaltensforschung und Tierkommunikation (z.B. über Körpersprache/Mimik, Laute/Worte und/oder Intuition) bis hin zu konventionellen und alternativen Therapiemöglichkeiten.
Deshalb verstehe ich auch, wenn Tierhalter/innen entweder verwirrt sind, was denn jetzt für das eigene Tier gut oder am besten ist, oder komplett aufgegeben haben, Tipps anderer anzunehmen.
Ich hoffe jedenfalls sehr, dass es mir gelingt, in meinen nächsten Beiträgen deutlich zu machen, in welchem Zusammenhang (für welches Tier, welche Vorgeschichte, welche Situation) meine Erfahrungen, Ideen, Empfehlungen zu sehen sind. Damit das, was für mich wichtig, sinnvoll, gut, hilfreich, richtig,… war oder ist, es auch für andere sein kann.
Denn das ist einfach das, was ich als (Lebens-)Wissenschaftlerin gerne tue: Probleme analysieren und lösen, für die andere noch keine Lösung gefunden haben.
Wem es zu lange dauert, bis ich neuen Themen in meinem Kopf die Struktur und Ordnung gegeben habe, um sie hier niederschreiben zu wollen (z.B. was während der Winterzeit und bei Kälte für das eigene Tier beachtet werden oder wie man einheimischen Wildtieren helfen kann), dem kann ich nur empfehlen, eines der vielen Bücher zu lesen, mit denen ich mich in den letzten Wochen und Monaten wie immer sehr kritisch auseinandergesetzt habe:
Zur Kommunikation von und mit Tieren die Bücher von Karsten Brensing „Die Sprache der Tiere. Wie wir einander besser verstehen“ & „Das Mysterium der Tiere: was sie denken, was sie fühlen„; von Eva Meijer „Die Sprachen der Tiere„; von Mario Ludwig „Gut gebrüllt! die Sprache der Tiere; von Andrea Kurschus „Meine Katze versteht mich – wie uns die Spiegelneuronen verbinden„; von Patricia B. McConnell „Das andere Ende der Leine – was unseren Umgang mit Hunden bestimmt“, von Andreas Ohligschläger „Vertrau auf deinen Hund – vom intuitiven Umgang mit Hunden“, von Liane Rauch „Hundetraining ohne Worte. Führen mit der leeren Hand“, von Asim Aliloski „Die geheime Seele meines Hundes und was das Verhalten meines Hundes über meine Persönlichkeit aussagt“ oder Pea Horsley „Was Dein Tier Dir sagen will„.
Außerdem von Dr. Pasquale Piturru „Hundeführerschein und Sachkundeprüfung“, von Jutta Ziegler „Tierärzte können die Gesundheit Ihres Tieres gefährden – neue Wege in der Therapie“ und so ziemlich alle Bücher zu Katzen von Tierarzt Michael Streicher.
Und für die, die es noch wissenschaftlicher mögen, von Karin Mölling „Supermacht des Lebens – Reise in die erstaunliche Welt der Viren“
Wer Einfluss auf meine zukünftige Themenwahl nehmen möchte, stellt mir am besten Fragen!
Dank für das Foto gebührt: George Miller on Unsplash
Gesundheit ist nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation der „Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens“.
Auf das Leben unserer Tiere würde ich sie so formulieren: „wenn sie keine körperlichen Schmerzen und/oder „Unpässlichkeiten“ haben, sich (geistig) zufrieden fühlen und keinen Stress im Allein- oder Zusammensein mit anderen (Artgenossen, anderen Tieren, Menschen) haben.“
Hm, für mich klingt das insgesamt leider ziemlich „schwammig“, wenn man genauer wissen will, WAS DENN GENAU JETZT NUN GESUND ODER GESUNDHEITSFÖRDERLICH IST…
Es erklärt aber wohl auch, warum es so unendlich viele unterschiedliche Meinungen und Empfehlungen gibt.
Als Tierhalter/in, der/die etwas für die Gesundheit des Haustieres tun möchte, kann man ziemlich schnell überfordert und frustriert sein von all den Informationen, die oft so widersprüchlich erscheinen.
Berücksichtigt man aber, dass Wohlbefinden etwas sehr Subjektives ist, wird eigentlich schnell klar, dass man, will man Gesundheitsvorsorge betreiben, FÜR DAS EIGENE TIER herausfinden muss, was IHM (IHR) gut tut und SEINE (IHRE) Gesundheit fördert und was nicht: Genauso wenig wie Menschen sind alle Tiere einer Art gleich, und was der eine mag oder der einen hilft, damit fühlen sich nicht gleichzeitig und immer auch alle anderen wohl.
Vermutlich kennen die meisten Tierhalter viele Anzeichen, wann es ihrem Tier gut geht und wann nicht, was ihm gut tut und was nicht. Leider übersehen sie dabei häufig mindestens einen der drei „Wohlfühlfaktoren“: KÖRPER, PSYCHE und SOZIALLEBEN.
Mir ist bewusst, dass der Begriff Psyche für Tiere umstritten ist; deshalb kann er gedanklich auch mit KOPF- oder GEHIRNTÄTIGKEIT ersetzt werde, auch wenn dadurch vielleicht die enge Verknüpfung mit GEFÜHLEN verloren geht.
Jedenfalls schafft man aus ganzheitlich orientierter Sicht die besten Voraussetzungen für eine dauerhafte Gesundheit des Haustieres, wenn jeder dieser drei Bereiche (mit entsprechender „Nahrung“) versorgt und keiner stark vernachlässigt wird, während man sich zu einseitig um einen anderen kümmert.
Je nachdem, wo und wie ein Tier lebt, was seinen individuellen Tagesablauf bestimmt, hat es sehr unterschiedliche (körperliche, geistige, soziale) Bedürfnisse, um sich in seiner Situation wohlzufühlen: Ein Tier, das viel (geistig und/oder körperlich) beschäftigt wird, braucht einerseits genug Nährstoffe bekommt, um Körper und Gehirn ausreichend zu versorgen, andererseits auch genug Möglichkeiten für Ruhe- und Erholungsphasen. Ist ein Tier ständig unter Menschen oder anderen Tieren (Sozialpartnern), braucht es vermutlich auch mal Zeit und Möglichkeiten, sich alleine zurückzuziehen und auszuruhen. Und wessen Tier viel alleine ist, ist vermutlich für jede Beschäftigungsmöglichkeit (z.B. Nahrungssuche, Dinge zum Erkunden) dankbar.
Es ist also meiner Erfahrung (mit Katzen, Hunden und verschiedensten anderen Kleintieren) nach die Kunst, eine BALANCE zwischen ZU VIEL DES EINEN und ZU WENIG EINES ANDEREN zu finden, ein ZU VIEL möglichst bald wieder AUSZUGLEICHEN, die das eigene Tier dauerhaft gesund hält. Wenn am Ende (möglichst jeden Tages) eine ausgeglichene Ruhe, herrscht, sozusagen ein körperliches, geistiges und soziales Wohlbefinden, kann ein Organismus genug neue Kraft schöpfen, den nächsten Tag ebenso zu bewältigen.
Extreme sind auch in der Natur eher lebensfeindlich und selten beständig. Irgendwann sorgt in jedem gesunden Organismus sozusagen ein Gegengewicht wieder für einen Ausgleich: Auf (An-)Spannung folgt Entspannung , nach der (Futter-)Jagd wird verdaut und geruht, auf einen erlebnisreichen Tag folgt tiefer Schlaf, auf Freiheitsdrang oft die Suche nach einem sicheren Plätzchen etc.
Als Tierhalter/in hat man im täglichen Zusammenleben viele Möglichkeiten, das eigene Tier zu beobachten, die eigenen Beobachtungen und Schlüsse immer wieder zu hinterfragen, also auch mal die Sichtweise anderer hinzuziehen oder Dinge zu verändern und neue auszuprobieren, sich zu informieren und jeden Tag etwas dazuzulernen, was dem Wohlbefinden des Haustieres, also seiner Gesundheit, dienen kann.
Vor allem, wenn das Tier dann doch mal krank wird.
Überreaktionen/Allergien, Unverträglichkeiten/Verdauungsbeschwerden, Appetitlosigkeit, Heißhungerattacken oder viele andere Verhaltensauffälligkeiten, diverse Mangelerscheinungen, Herz-Kreislauf-Beschwerden u.v.m. zeigen nämlich recht deutlich, dass ihm jetzt etwas fehlt (oder auch zu viel ist) und es etwas anderes gebraucht hätte. Und dass es Zeit ist, etwas zu ändern, vielleicht nach Ursachen, aber vor allem nach den Dingen zu suchen, mit denen es dem Tier wieder besser/gut geht.
Davon dass Tiere schon sehr früh signalisieren können (v.a. mit Körpersprache – Haltung, Gebärden, Mimik -, Tönen oder auch Gerüchen), wenn ihnen etwas fehlt oder zu viel ist, wir also die Möglichkeit haben, sehr früh darauf zu reagieren, und wie spannend die Kommunikation zwischen Tier und Mensch sein kann, schreibe ich bestimmt ein nächstes Mal.
Als Biologin habe ich gelernt, dass sich Zellen lebendiger Wesen täglich erneuern, im Laufe der Zeit also ganze Organe, und dass angeblich nach etwa 7 Jahren der gesamte Organismus keine der ursprünglichen Zellen mehr „besitzt“. Daher habe ich mich schon oft gefragt, warum Menschen und Tiere nicht wie nach Verletzungen auch bei allen Krankheiten mit der Zeit heilen. Und ich habe bis heute noch keinen Gegenbeweis dafür gefunden, dass das möglich ist. Wenn die Ursache der Erkrankung beseitigt ist. Denn selbst das Argument, dass etwas genetisch bedingt und daher unmöglich zu ändern sei, ist durch (epigenetische) Forschungsergebnisse stark ins Wanken gekommen. Nicht alles, was in den Genen verankert liegt, hat auch körperliche Folgen. Weil lebende Organismen „regeln“ oder vielmehr dabei beeinflusst werden können – u.a. durch Ernährung, Bewegung, selbst psychosomatisch – , welche ihrer Gene „exprimiert werden, also welche ihrer Informationen in einem Organismus überhaupt in Erscheinung treten.
In den letzten drei Jahren hat sich mein Verständnis von Krankheiten enorm gewandelt, und selbst sehr viel von dem, was ich in meinem Biologie-Studium vermittelt bekam, wurde ziemlich auf den Kopf gestellt: Wie Krankheiten entstehen (dazu bestimmt ein anderes Mal mehr), aber auch, wie sie wieder vergehen.
Ich war lange Zeit, wahrscheinlich wie die meisten Menschen, überzeugt, dass man Krankheiten mit Medikamenten heilen kann. Und habe mich gewundert, dass das anscheinend nie bei allen (Tieren wie Menschen) funktioniert. Also habe ich mich intensiv mit Büchern von Ärzt/Innen und Wissenschaftler/Innen auseinandergesetzt, von denen man in den gängigsten Medien kaum etwas (oder noch wenig?) hört oder liest: EpigenetikerInnen, EvolutionsmedizinerInnen, NeurowissenschaftlerInnen. Dass manche von ihnen hin und wieder als „unwissenschaftlich“ betitelt werden, wundert mich nicht; weil sich viele ihrer Erkenntnisse nicht in großen Studien beweisen lassen. Und weil sich deshalb wohl auch viele renommierte Zeitschriften weigern, ihre Ergebnisse zu veröffentlichen.
Darin kommt immer wieder die Einzigartigkeit jedes Lebewesens, eben jedes Individuums, zum Ausdruck; also seine jeweils einzigartigen Lebensumstände und Erfahrungen, die auch zu den verschiedensten Krankheitsbildern führen können. Auch Bedürfnisse, hinsichtlich Ernährung, Ruhe, körperlicher und geistiger Auslastung, sind individuell selbst innerhalb einer (Tier-)Art sehr unterschiedlich und können bei Nichterfüllung Krankheitssymptome hervorrufen. Da ein Körper aber nicht unendlich viele Organe hat, in denen sich diese zeigen können, leiden Menschen wie Tiere aus den unterschiedlichsten Gründen an ähnlichen Beschwerden. Nicht nur die chinesische Medizin behandelt auf dieser Grundlage ja schon lange Zeit erfolgreich; und ich habe endlich verstanden, warum in unserer westlichen Schulmedizin ein Mittel, das dem einen hilft, die Leiden einer anderen unter Umständen sogar verschlimmern kann. Weil dieselben oder ähnliche Krankheitssymptome oft nicht Ausdruck derselben Ursache sind. Weil eine Heilung nur möglich ist, wenn eine Krankheitsursache beseitigt ist. Weil Medikamente stark in natürliche (Heilungs-)Prozesse eingreifen oder diese sogar behindern können. Weil die Psyche einen enormen Einfluss auf ein Krankheitsgeschehen hat, auf seine Entstehung und Heilung. Weil in der Medizin oft zu einseitig gedacht und behandelt wird.
Medikamente können alle möglichen Symptome unterdrücken oder Fehlfunktionen ausgleichen, die Organismen zeigen, wenn sie nicht gut – also artgerecht, entsprechend natürlicher Bedürfnisse, aber auch entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse – versorgt sind. Sie können einen Körper abhängig von ihrer Wirkung machen. Aber sie können ein Tier nicht gesund machen. Weil sie keine Ursachen beseitigen, Körper nicht dazu bringen können, Mängel oder Überversorgungen wieder eigenständig auszugleichen.
Ein gesunder Organismus ist in der Lage, auch über lange Zeit ohne Symptome, die auf eine Krankheit hindeuten, zu funktionieren. Auch wenn seine Lebensbedingungen nicht optimal sind. Weil es in der Natur immer wieder Zeiten des Mangels und des Überflusses gab und gibt. Arten, die sich daran nicht angepasst haben, sind entweder ausgestorben oder leben nur auf territorial sehr begrenzten Gebieten, in denen sich die Lebensbedingungen nie stark ändern. Viele unserer Haustiere sind allerdings über die ganze Welt verbreitet, müssen aus biologischer Sicht also enorm anpassungsfähig sein. Meine Beobachtungen und Erfahrungen bestätigen das immer wieder. Während meiner Arbeit im Tierheim und auch mit Wildtieren habe ich mich oft gewundert, dass trotz des täglichen Stresses so viele Tiere keine Anzeichen von Krankheiten aufweisen. Dass sie sich mit der Situation abfinden oder einfach eine gewisse Zeit durchhalten. Die aber, davon bin ich überzeugt, ihre Spuren hinterlässt; wenn auch äußerlich nicht sofort sichtbar.
Auf der anderen Seite habe ich immer wieder auch sehr kranke Tiere gesehen, die in einem neuen Zuhause gesund wurden. Habe von fast unglaublichen Heilungen gehört und gelesen. Unglaublich deshalb, weil wohl den wenigsten Menschen bewusst ist, welch enormes Heilungspotenzial die Natur Lebewesen mit auf den Weg gegeben hat.
Aber genauso selten wird man auch der vielfältigen Gefahrenquellen gewahr, die es für ein gesundes Leben gibt. Weil nicht alle sofort eine gesundheitliche Auswirkung zeigen. Weil kurzzeitig die meisten Lebewesen jede Art von gesundheitlichen Stressfaktoren gut verkraften. Weil Warnzeichen übersehen oder missachtet werden, dass etwas dauerhaft die Gesundheit schädigt.
Unsere Haustiere können uns nicht sagen, ob ihnen etwas fehlt oder ob etwas zu viel für sie ist. Und viele Menschen kennen vielleicht nicht einmal ihre anderen Ausdrucksmöglichkeiten. Wissen nicht, dass Tiere mit ihrem Körper und Verhalten zeigen können, wenn sie gestresst oder körperlich und geistig unterfordert sind, Schmerzen oder Angst haben, unausgewogen ernährt werden, um nur einige zu nennen. All das macht auf Dauer nicht nur Menschen krank.
Um also Krankheiten vorzubeugen, Ursachen bestehender Erkrankungen aufzuspüren und im besten Fall zu beseitigen oder Nebenwirkungen von Medikamenten, auf die ein Tier schon angewiesen ist, gering zu halten, kann es enorm hilfreich sein, die dahinter liegenden biologischen Vorgänge zu verstehen. Zu lernen, Verhaltensweisen aus biologischer Sicht zu beobachten und zu deuten. Sich intensiv und dauerhaft mit seinem Tier zu beschäftigen, neue Dinge auszuprobieren. Um jede Heilung bestmöglich zu unterstützen.
2018 habe ich meinen ersten Hund bekommen. Haben wollte ich nie einen. Obwohl ich im Grunde alle Arten von Tieren liebe, habe ich mich lange Zeit eher als Katzenmenschen beschrieben. Und auch viele Jahre lang zusammen mit Katzen gelebt. An den Katzen als Begleiterinnen des menschlichen Lebens mag ich einfach besonders, dass sie auch mal ihre eigenen Wege gehen. Solange man ihnen in Form von Freigang die Möglichkeit dazu gibt. Weil ich dann ein bisschen verschnaufen kann von der Verantwortung, die ich mir mit der Haltung eines Haustiers „aufgeladen“ habe. So geht es mir wirklich. Ich fühle mich verantwortlich dafür, dass es „meinem“ Tier gut geht. Ich bin verantwortlich dafür, dass es etwas und was es im Fress- und Trinknapf vorfindet. Dass es seine sonstigen alltäglichen Bedürfnisse ausleben kann, Ruhe- und Rückzugsplätze findet. Dass es Beschäftigung und Abwechslung in seinem Leben hat, also einerseits lernt, mit neuen Situationen umzugehen, es andererseits aber auch Routinen gibt, auf die es sich verlassen kann. Dass ich sehe, wenn ihm etwas fehlt oder es ihm schlecht geht. Dass es versorgt ist, wenn ich unterwegs bin und es nicht mitnehmen kann.
Ein Rudeltier wie den Hund also bei mir einzuquartieren, war mir nie in den Sinn gekommen. Weil der ja eigentlich immer und überall dabei sein will. Im letzten Jahr habe ich mich dann zusammen mit dem Einzug ins Haus meines Freundes auch für Peppie entschieden. Die 13-jährige Australian Terrier-Hündin mit mehr als einer Macke – z.B. Trennungsängsten und Angstaggression, Neigung zu epileptischen Anfällen und vor gut 2 Jahren diagnostiziertem Diabetes -, die er nach Absprache mit mir von einer Freundin adoptiert hatte und die fast zeitgleich mit mir bei ihm einzog. Ideal als Anfängerhund! Zumindest für mich! Um endlich die theoretischen Weisheiten in Sachen Tiergesundheit, die ich mir schon seit Jahren oder fast Jahrzehnten anlese und anhand meiner Beobachtungen während meiner Arbeit mit Tieren überprüft und auch immer wieder hinterfragt habe, praktisch am eigenen Tier im privaten Alltag anzuwenden. Ideal, um zu erfahren, dass Theorie und Praxis so sehr auseinanderklaffen können. Ideal, um an dem, was man bisher weiß, zu scheitern, Alternativen zu suchen, neue Ideen zu entwickeln und anderes zu versuchen. Und aus den Erfolgen, aber vor allem den Misserfolgen zu lernen.
Ich habe lange gebraucht, um mir jetzt so sicher zu sein, dass ich auch Ihrem Tier helfen kann. Mit meinem biologischen Hintergrundwissen und meinen beruflichen Erfahrungen mit Haus- und Wildtieren, die im Tierheim oder Gefangenschaft unter enormen Stressbedingungen leben oder gelebt haben. Ich habe erlebt, wie kleine Veränderungen in der Tierhaltung oder auch im eigenen Verhalten dem Tier gegenüber große Auswirkungen auf Tiere haben können, wie anders, munterer, aufgeweckter, vielleicht fröhlicher Tiere wirken können, wenn sie ihre natürlichen Bedürfnisse ausleben können. Wie sehr sich ein anderes Futter auf den Gesundheitszustand eines Tieres auswirken kann. Wie unnötig manchmal Medikamente sein können, wenn man etwas anderes versucht.
Ich habe meine Arbeit im Tierheim aufgegeben, wo Vorschriften und Tierärzte bestimmen, wie den Tieren ‚geholfen‘ wird. Wo mir fast keine Möglichkeit gegeben wurde, auf zum Teil sehr individuelle Bedürfnisse von Tieren einzugehen. Ich bin überzeugt, dass nur die Menschen, die die meiste Zeit mit einem Tier verbringen, dem Tier wirklich helfen können. Weil sie sein Verhalten in verschiedenen Situation am Genauesten beobachten und Schlüsse daraus ziehen können, die zur Beurteilung einer Krankheit oder eines auffälligen Verhaltens wichtig sind. Aber ich stelle leider auch immer wieder fest, dass viele Tierhalter ihre Tiere zu sehr vermenschlichen, d.h. ihre Verhaltensweisen und auch Krankheitszeichen zu sehr aus menschlicher Sicht deuten. Genau hier sehe ich meine Chance, meine Aufgabe. Ich kann Ihnen mit Rat und bestimmt auch mancher Tat zur Seite stehen, wenn Sie dafür sorgen möchten, dass Ihr Tier ein möglichst gesundes, zufriedenes Leben führt. Ich freue mich darauf!
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Dr. Kerstin Reuther
Niederseelbacher Straße 31
65527 Niedernhausen
+49 6127 506 2475
+49 176 2984 9394
dr.reuther@gesundes-heimtierleben.de
Diese Seite nutzt Cookies. Mit der weiteren Nutzung dieser Website stimmen Sie diesen zu. Welche Daten genau erhoben werden, lässt sich unter "mehr erfahren" nachlesen. Ich persönlich erhebe keine.
OKmehr erfahrenWir können Cookies anfordern, die auf Ihrem Gerät eingestellt werden. Wir verwenden Cookies, um uns mitzuteilen, wenn Sie unsere Websites besuchen, wie Sie mit uns interagieren, Ihre Nutzererfahrung verbessern und Ihre Beziehung zu unserer Website anpassen.
Klicken Sie auf die verschiedenen Kategorienüberschriften, um mehr zu erfahren. Sie können auch einige Ihrer Einstellungen ändern. Beachten Sie, dass das Blockieren einiger Arten von Cookies Auswirkungen auf Ihre Erfahrung auf unseren Websites und auf die Dienste haben kann, die wir anbieten können.
Diese Cookies sind unbedingt erforderlich, um Ihnen die auf unserer Webseite verfügbaren Dienste und Funktionen zur Verfügung zu stellen.
Da diese Cookies für die auf unserer Webseite verfügbaren Dienste und Funktionen unbedingt erforderlich sind, hat die Ablehnung Auswirkungen auf die Funktionsweise unserer Webseite. Sie können Cookies jederzeit blockieren oder löschen, indem Sie Ihre Browsereinstellungen ändern und das Blockieren aller Cookies auf dieser Webseite erzwingen. Sie werden jedoch immer aufgefordert, Cookies zu akzeptieren / abzulehnen, wenn Sie unsere Website erneut besuchen.
Wir respektieren es voll und ganz, wenn Sie Cookies ablehnen möchten. Um zu vermeiden, dass Sie immer wieder nach Cookies gefragt werden, erlauben Sie uns bitte, einen Cookie für Ihre Einstellungen zu speichern. Sie können sich jederzeit abmelden oder andere Cookies zulassen, um unsere Dienste vollumfänglich nutzen zu können. Wenn Sie Cookies ablehnen, werden alle gesetzten Cookies auf unserer Domain entfernt.
Wir stellen Ihnen eine Liste der von Ihrem Computer auf unserer Domain gespeicherten Cookies zur Verfügung. Aus Sicherheitsgründen können wie Ihnen keine Cookies anzeigen, die von anderen Domains gespeichert werden. Diese können Sie in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers einsehen.
Wir nutzen auch verschiedene externe Dienste wie Google Webfonts, Google Maps und externe Videoanbieter. Da diese Anbieter möglicherweise personenbezogene Daten von Ihnen speichern, können Sie diese hier deaktivieren. Bitte beachten Sie, dass eine Deaktivierung dieser Cookies die Funktionalität und das Aussehen unserer Webseite erheblich beeinträchtigen kann. Die Änderungen werden nach einem Neuladen der Seite wirksam.
Google Webfont Einstellungen:
Google Maps Einstellungen:
Google reCaptcha Einstellungen:
Vimeo und YouTube Einstellungen:
Sie können unsere Cookies und Datenschutzeinstellungen im Detail in unseren Datenschutzrichtlinie nachlesen.